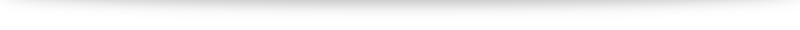Ich saß an meinem schlichten weißen Schreibtisch im Büro – nichts weiter als eine Arbeitsplatte und vier schlanke Tischbeine. Das Wenige, das sich in diesem eher spartanischen Raum befand, war unspektakulär.
Vor mir stand ein eingeschalteter Commodore-64-Computer mit Diskettenlaufwerk. Ich sah auf dessen Monitor und überflog einen selbstgeschriebenen Text. Grelles Sonnenlicht fiel durch das Fenster hinter mir und spiegelte sich auf dem Bildschirm, was das Lesen erschwerte. Die Hitze brannte auf meinem Rücken und drückte mir feuchte Schweißperlen auf die Stirn. Langsam rann ein Tropfen herunter.
Die Luft war warm und stickig. Das Fenster war auf Kipp und die Tür an der Wand geradeaus war in der Hoffnung auf Durchzug geöffnet.
Plötzlich klingelte das Telefon. Mein Körper zuckte zusammen.
Es läutete. Einmal. Zweimal. Dreimal.
Schließlich hob ich den Hörer ab und presste ihn ans Ohr. „Guten Tag, hier ist die Partnervermittlung Poniewas. Was kann ich für Sie tun?“, sagte ich mit höflicher Stimme.
Mit einem leichten Lächeln im Gesicht wartete ich auf eine Antwort. Doch es war still. Ich hörte einen Atemzug, und dann ertönte der Besetzton – der Anrufer hatte aufgelegt.
Die gespielte Freundlichkeit fiel von mir ab und ich ließ den Hörer langsam auf die Gabel sinken. Es wäre zu schön gewesen, murmelte ich.
Es herrschte wieder Stille. Sekunden vergingen. Ich starrte ins Nichts, bis mein Blick mechanisch zur Uhr an meinem Handgelenk glitt – 17:03 Uhr.
Ich sah auf den Brotkasten – wie mein Computermodell im Volksmund genannt wurde. Ich selbst war da persönlicher; meiner hatte einen Namen. „Tja, Charly…“, seufzte ich. „Heute springt wohl auch kein Vertrag für uns raus.“
Es war meine letzte Chance, um an einen hohen Betrag zu kommen – morgen würde es mich hier nicht mehr geben.
Ich drehte meinen Kopf nach links, wo zum Greifen nah ein hüfthohes, weißes Regal stand. Weder das Radio, noch die Bücher oder die verstreuten Unterlagen in den Regalen konnten in diesem Moment mein Interesse wecken. Mein Blick fiel auf einen handgroßen Bilderrahmen auf dem obersten Brett. Darin war das Foto eines jungen Paares zu sehen; es mochte Anfang zwanzig sein und strahlte glücklich in die Kamera.
Beide waren konservativ gekleidet; er in einem dunkelblauen Anzug, sie in einem schlichten schwarzen Kleid. Sie war eine attraktive, schlanke Frau mit einem blonden Schopf, der ihr bis auf die Schultern fiel. Auf dem Foto wirkte sie sehr charmant, ja fast unschuldig.
„So eine hätten viele Männer gern“, murmelte ich – und musste zufrieden lächeln, denn der Mann neben ihr auf dem Foto war ich.
Mein Lob bezog sich nicht nur auf ihr Äußeres. Ich war insgesamt sehr zufrieden mit ihr.
Mit beiden Händen griff ich mir an die Krawatte, lockerte den Knoten und holte tief Luft. Dann wandte ich mich wieder Charly zu.
Da – wieder dieses Klingeln. Diesmal riss ich den Telefonhörer hoch. „Guten Tag, hier ist—“, begann ich mechanisch, doch eine vertraute Stimme schnitt mir das Wort ab.
„Ich bin’s“, hörte ich meinen Vater sagen – der zugleich mein Chef war.
Ich antwortete mit einem: „Aha.“ Im Hintergrund klackerte eine elektronische Schreibmaschine. Er war definitiv in der Mönchengladbacher Zentrale.
„Ist bei dir in Aachen was los?“, fragte er.
„Nein. Es haben sich heute keine Partnersuchenden bei dir gemeldet. Die ganze Woche war schlecht“, antwortete ich mit mürrischer Stimme.
„Ich habe auch nur wenig Werbung geschaltet“, räumte er ein.
Ich zuckte mit den Schultern. „Aber Anrufe, bei denen jemand einfach auflegt, habe ich häufiger als sonst.“ Ich kicherte kurz. „Ich glaube, jemand kontrolliert, ob ich noch immer für dich arbeite.“
„Dass heute dein letzter Tag ist, weiß doch niemand“, sagte mein Vater.
Nach kurzem Überlegen fragte ich: „Wer arbeitet ab Montag hier? Kommt die männliche Venusfalle zurück?”
Mein Vater wusste sofort, wen ich meinte und worauf ich anspielte. „Du weißt genau, dass er sich sofort an die Kundinnen heranmacht, sobald man nicht hinsieht.“
Oh, das wusste ich nur zu gut. Der Mann war ein wahrer Meister darin, private Vorteile mit geschäftlichen zu verquicken. Insbesondere bei Frauen. (Was reimt sich auf verquicken?)
Aber auch mein Vater griff schon mal selber zu. Denn manchmal kommt der Appetit eben erst, wenn das Essen aufgetischt ist.
Ich sah und erlebte persönlich, dass sich auch attraktive Frauen, ob jung oder älter, an uns wandten und im Büro erschienen.
Außerdem war mir bekannt, dass sowohl die weiblichen als auch die männlichen Angestellten meines Vaters ein überdurchschnittliches Gehalt bezogen.
Das galt sogar für mich als Aushilfskraft.
Ich war lange zufrieden. Dennoch hörte ich hier auf.
Ich lachte kurz auf.
„Was gibt es da zu lachen? Ich habe noch keinen Ersatz für dich“, sagte er.
Ein Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus – ein schadenfrohes.
Er fuhr fort: „Ohne dich muss ich die Aachener Filiale vorübergehend schließen.“
Erst jetzt schien ihm zu dämmern, was ich ihm wert war. Doch meine Entscheidung war gefallen.
Bezüglich des Personalmangels hätte ich ihn gerne weitergestrichelt. Ist mein Vorgänger eigentlich schon aus dem Knast? – Der Satz brannte mir auf der Zunge. Doch ich ließ ihn ungesagt.
In den letzten zwei Jahren hatte ich oft mit zwielichtigen Charakteren zu tun, was mein Bild von der Branche, aber auch den Kunden trübte.
In diesem Moment ertönte die Türklingel. „Das wird Mary sein – sie wollte mich abholen. Warte bitte kurz.“
Ich legte den Hörer neben das grüne Telefon, schlenderte am Regal sowie am Schreibtisch vorbei und ging in die Diele. Dort öffnete ich die Eingangstür. Und da stand sie vor mir und lächelte: Mary!
Ich musterte sie flüchtig. Sie trug einen knielangen, schwarzen Rock und eine hochgeschlossene, weiße Bluse. Ihr Outfit war spießig, wie meistens. Dazu war sie dezent geschminkt. „Du bist aber früh dran“, sagte ich hastig, drückte ihr einen Kuss auf die Wange und drehte mich sofort wieder um.
Während ich zurück ins Arbeitszimmer hetzte, hörte ich sie rufen: „Ich bin direkt nach Feierabend losgefahren – die Autobahn war wie leergefegt!“
Die Sonne knallte mir ins Gesicht, als ich das Zimmer betrat. Ich ging bis zum Anfang des Schreibtisches, aber nicht um ihn herum. Mit ausgestrecktem Arm griff ich über die Arbeitsfläche und nahm den Hörer in die Hand. „Sie ist da!“, verriet ich meinem Vater.
„Mary ist bis Aachen gefahren, nur um dich abzuholen?”
Normalerweise pendelte ich die 60 Kilometer zwischen Aachen und zu Hause mit dem Zug – das wusste er. Doch heute gab es einen guten Grund, warum Mary kam. „Sie ist nur hier, weil ich meinen Computer nach Hause mitnehmen werde“, erklärte ich.
Mary war mir gefolgt. Sie huschte an mir und dem Regal vorbei und machte sich auf der anderen Schreibtischseite auf meinem Platz breit.
„Dann halte ich euch nicht länger auf!“, sagte mein Vater in diesem Moment.
Ich überlegte kurz, ob ich ihn um Geld bitten sollte, entschied mich aber dagegen. Ich war zu feige. „Tschüss“, sagte ich und beendete das Telefonat abrupt, indem ich den Hörer unsanft auflegte.
Unverzüglich deutete Mary auf den Bilderrahmen im Regal. „Da steht ein Foto von uns!“, rief sie begeistert.
„Das ist schon seit Wochen dort.” Ich hielt kurz inne, dann fügte ich mit einem Augenzwinkern hinzu: „Aber natürlich nur aus beruflichen Gründen.“
Ihre Augenbrauen zuckten nach oben. „Aus beruflichen Gründen?“
„Was denn sonst? Du siehst gut aus, und die Kunden sollen ruhig sehen, dass ich durch die Firma einen guten Fang gemacht habe.“ Ich achtete darauf, dass mein Tonfall eine Mischung aus Humor und Sarkasmus ausstrahlte.
„Durch die Firma?” Marys Mundwinkel zuckten – dann durchbohrten mich ihre blaugrauen Augen. „Du belügst also die Partnersuchenden und behauptest, ich wäre eine Kundin gewesen?“
„Belügen? Ich würde es lieber ‚kreative Verkaufsrhetorik‘ nennen. Ihr nehmt es in der Bank mit der Wahrheit ja auch nicht sehr genau“, konterte ich mit einem schelmischen Grinsen.
Ihr Blick glitt zum Bildschirm. Es folgte ein kurzes Schweigen. „Was schreibst du da?“, fragte sie. Sie beugte sich vor und begann mit gespielter Feierlichkeit vorzulesen: „Ich wurde 1965 in Mönchengladbach geboren.“ Sie hielt inne und runzelte die Stirn. „Das weiß ich doch.“
Ich war 21 Jahre alt und sie ein paar Monate jünger.
Ich ging zu ihr, trat hinter sie und legte ihr meine Hände auf die Schultern. Ein Lächeln spielte um ihre Lippen. „Verfasst du etwa deine Autobiografie?“
Meine Finger glitten durch ihr schulterlanges, blondes Haar. „Dafür bin ich noch zu jung. Ich habe nur ein paar Notizen über meine Erlebnisse hier gemacht. Zeit hatte ich schließlich genug.”
„Du hattest hier ein bequemes Leben“, erwähnte sie, und damit hatte sie recht. Tatsächlich hatte ich mich im Büro noch nie überarbeitet.
Mein Blick wurde ernst. „Das wird sich bei der Bundeswehr gründlich ändern.“
Mary nickte und sagte leise: „Ich lese noch ein wenig weiter.“
„Das kannst du später zu Hause machen”, entgegnete ich.
Sie drehte ihren Kopf zu mir. „Hast du dein Vermittlungsprogramm weiterprogrammiert?”
„Ja! Das kann ich dir mal zeigen. Aber nicht jetzt!” Ich schritt an ihr vorbei und schaltete den Monitor sowie den Rechner aus. Es gab keinen Grund für mich, länger im Büro zu bleiben.
Nur wenige Minuten später lag Charly samt Monitor im Kofferraum von Marys weißem Opel Kadett, der in einer Seitenstraße nahe dem Büro geparkt war. Meinen ledernen Aktenkoffer, in dem ich die Disketten verstaut hatte, nahm ich mit.
Doch wir fuhren nicht sofort los. Anstatt einzusteigen, blieb Mary am Wagen stehen und blickte hinüber zu einem Bistro auf der anderen Straßenseite. Auf dem Bürgersteig davor standen bestuhlte Tische, an denen Menschen saßen. Es war voll, aber nicht überfüllt. Der klare Himmel und die strahlende Sonne luden geradezu dazu ein, draußen Platz zu nehmen.
„Da war ich noch nie”, sagte ich und deutete mit der rechten Hand zum Bistro. “Was hältst du davon, wenn wir noch etwas in Aachen bleiben?” Mein Vorschlag entsprang mehr einem Impuls als einer durchdachten Idee.
Mary nickte zustimmend.
An diesem Freitag hatten wir beide nichts Besonderes vor – keine Pflichten, keine Eile. Nur Zeit. Zumindest bis Montag früh.
Ohne ein Wort zu verlieren, überquerten wir die Straße und ergatterten den letzten freien Tisch. Wir rückten zwei Stühle eng zusammen, während ein dritter leer blieb. „Ich nehme eine Cola“, sagte Mary. Sie wirkte zufrieden, als sie mich ansah.
Um uns herum ein Stimmengewirr, Musik und das Klirren von Gläsern. Vorsichtig legte ich meine rechte Hand auf ihr blankes Knie und musterte die Umgebung. Die Gäste waren eine Mischung aus Paaren sowie kleinen Gruppen in unserem Alter. Eine brünette Kellnerin, etwas älter als wir und luftig gekleidet, schlenderte mit einem leeren Tablett in der Hand an unserem Tisch vorbei – ohne uns zu beachten. Mein Auge folgte ihr, bis sie sich wenig später im Lokal an der Theke auf einen Barhocker setzte.
„Tsss“, zischte ich gut hörbar, schüttelte fassungslos den Kopf und wandte mich wieder Mary zu.
Doch sie blickte nicht zu mir. Stattdessen hafteten ihre Augen mit einem vieldeutigen Lächeln auf den Lippen an der Kellnerin. Mary schien in Gedanken versunken. Was hat sie nur?, dachte ich.
Plötzlich, ohne jede Vorwarnung, beugte sie sich zu mir herüber. Ihre Lippen berührten meine Wange – kurz, aber fordernd. „Die gefällt mir”, flüsterte sie mir ins Ohr, befeuchtete sich die Lippen mit der Zungenspitze und fügte hinzu: „Die ist was für uns beide. Ein perfektes Abschiedsgeschenk, oder?”
Die Luft stockte mir in der Kehle. Daran, dass Mary es ernst meinte, zweifelte ich keinen Moment. Überraschten mich ihre Worte? Ja und nein! Ihr erotisches Interesse an Frauen war mir nicht neu. Sie hatte sich schnell bei mir geoutet. Sogar den Wunsch, mich mit einer anderen Frau zu teilen, hatte sie mir bereits anvertraut.
Doch sollte es heute wirklich geschehen? Mein Blick schoss zu ihrer Auserwählten, die ich nun mit anderen Augen betrachtete – neugieriger, vielleicht sogar ein wenig lüstern.
Eine schlanke Blondine und eine vollbusige Dunkelhaarige im Bett – die Vorstellung gefiel mir. Doch ich sah nur kurz zu ihr hin. Zu viel Interesse zu zeigen hielt ich für falsch.
Langsam hob Mary ihre Hände. „Und sie hat mehr Busen als ich“, murmelte sie mit funkelnden Augen. Das stimmte. Dachte sie in diesem Moment an ihr eigenes Vergnügen oder an meins?
Dann, in einer fast schon theatralischen Geste, griff sie sich an den Blusenkragen und öffnete die oberen beiden Knöpfe. Sie zeigte nun Haut, aber kein erwähnenswertes Dekolleté.
Ich grinste. „Geh doch zu ihr und sprich sie an“, forderte ich Mary auf und zog meine Hand von ihrem Knie zurück. „Und wenn du schon dort bist, kannst du gleich etwas zu trinken bestellen. Für mich bitte ein Glas Weißwein.“
Sie lächelte. „Du lebst in dem Luxus, nicht fahren zu müssen.“
„So bin ich“, entgegnete ich verschmitzt und ließ meinen Kopf langsam nach links und rechts schweifen.
„Das mit dem Mädel ist mein Ernst“, beharrte Mary. Mein Nicken schien sie zu bestärken. „Sag mal“, setzte sie nach, „in deinem Vermittlungsprogramm solltest du vielleicht auch sexuelle Neigungen berücksichtigen.“
Wie sie nun auf dieses Thema kam, wusste ich nicht. Ich nahm ihre Aussage als Scherz auf. „Ja nee, ist klar“, brummte ich und tätschelte ihr das Knie. „Nicht alle sind so aufgeschlossen wie du.“
„Genau deswegen“, sagte Mary selbstbewusst.
„Ich habe einiges geplant”, verriet ich dann, ohne Einzelheiten nennen zu wollen. Ich hatte mehr Ideen, als ich mit dem Computer umsetzen konnte. Ich wollte mir bald einen besseren anschaffen.
Mary blinzelte gegen die tiefstehende Sonne. „Hast du heute mit deinem Vater gesprochen? Hast du ihn gefragt, ob du nach der Bundeswehr bei ihm weiterarbeiten kannst?“
„Das hat noch anderthalb Jahre Zeit“, erwiderte ich und kicherte leise. „Die eigentliche Frage ist doch, ob ich das überhaupt will.“
„Etwas Besseres wirst du mit deiner Berufsausbildung kaum finden.“ Damit hatte sie wohl recht. Als Verkäufer im Einzelhandel konnte ich nicht viel erwarten.
„Vielleicht habe ich ja moralische Bedenken!“, erklärte ich mit fester Stimme.
Mary sah mich fragend an. „Manches, was du im Büro erlebt hast, könnte man durchaus als toxisch bezeichnen.“
Ich überlegte einen Moment, was sie mit „toxisch“ meinte. „Du meinst also diese merkwürdigen Mitarbeiter und die sonderbaren Kunden?“ Bevor Mary etwas erwidern konnte, fuhr ich fort: „Eigentlich wäre es gar nicht schlecht, ein Buch über den Beruf zu schreiben.“
Ein kurzes Lachen entfuhr ihr. „Ein Enthüllungsbuch? Du willst verraten, wie Partnersuchende über den Tisch gezogen werden?“
Ich zuckte mit den Schultern. Doch sie hakte nach: „Oder doch eine Autobiographie?“
„Ich schreibe über Privates und Berufliches. Den ersten Teil nenne ich Lehrjahre.”
„Den ersten Teil?“, fragte Mary überrascht und schüttelte ungläubig den Kopf.
„Vielleicht gebe ich auch Tipps, wie man Frauen wie dich kennenlernt.”
Ich sah sie langsam und eindringlich von Kopf bis zu den Füßen an.
„Halt mich da bitte raus“, bat sie.
„Nein! Du steckst bereits im Schlamassel.” Ich erhob meinen Kopf. “Um meine Erfolgsstory werden sich Filmproduzenten reißen.”
Manchmal war ich etwas großkotzig, was eine Art Selbstschutz war.
Einige Sekunden lang wirkte Mary fassungslos. Dann sagte sie charmant: „Du übertreibst, Schatz.”
Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. Normalerweise sprachen Mary und ich nie lange über die Arbeit – und schon gar nicht über unser Gefühlsleben. Doch die bevorstehende Trennung machte uns redseliger als sonst.
Und dann geschah es: Unbemerkt von uns trat die Bedienung an den Tisch. Ich gab unsere Bestellung auf. Kaum war sie gegangen, bemerkte Mary leise: „Sie ist verheiratet und trägt einen Ehering.” Plötzlich gab sie mir einen flüchtigen Kuss und fügte hinzu: „Das wird wohl nichts. Wir suchen uns irgendwann eine andere.“
Ich nickte zustimmend.
Wir genossen den Abend und die letzten gemeinsamen Tage, die uns noch blieben. Bald schon würde für mich ein neues Leben beginnen.
Die Idee für dieses Buch brannte sich allerdings wie ein Feuerblitz in mein Bewusstsein – eine Erinnerung, die nie verblasste. Ihre Umsetzung jedoch sollte am Ende viel länger dauern, als ich es mir je hätte träumen lassen.
Heute, Jahre später, hält Mary das fertige Buch in Händen. Genau wie nun viele andere Leserinnen und Leser.
Allen wünsche ich von Herzen viel Freude beim Eintauchen in diese wahre Geschichte